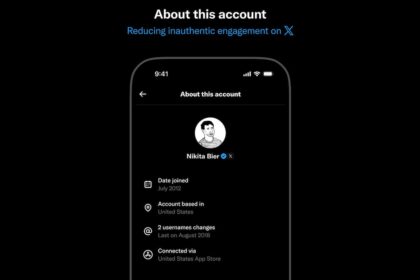Der Gesetzesentwurf des Justizministeriums gegen Hass im Netz wird viel und heftig kritisiert. Zum Teil zu Unrecht, wie ich finde. Ein Kommentar.
Vor knapp einer Woche, letzten Dienstag, hat Justizminister Heiko Maas einen lang erwarteten Gesetzesentwurf zur „Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken“ präsentiert. Er sieht vor, dass Nutzer von sozialen Netzwerken rechtswidrige Inhalte leicht melden können und diese Inhalte auch zeitnah von der Plattform entfernt werden.
Innerhalb von 24 Stunden sollen beispielsweise Hasskommentare verschwinden, die „offensichtlich rechtswidrig“ sind, bei nicht ganz so klaren Fällen sieht der Entwurf eine Löschfrist von sieben Tagen vor.
Gleiches gilt für Kopien und das erneute Veröffentlichen dieser Inhalte. Und damit sich die Plattformbetreiber wie Facebook Twitter und Co. auch an die Vorschriften halten, müssen sie bei Nichteinhaltung der Fristen bis zu 50 Millionen Euro zahlen.
Dem Entwurf ging eine freiwillige Einigung des Ministeriums mit den Plattformbetreibern, vor allem Facebook, Twitter und Youtube, in Form einer Task Force voraus. Sie erklärten sich einverstanden, deutsches Recht besser anwenden zu wollen, gemeldete Inhalte zu prüfen und unter Umständen zu löschen.
Plattformbetreiber kommen ihren Pflichten nicht nach
Eine Untersuchung von jugendschutz.net zeigte nun aber, dass lediglich Youtube dieser Vereinbarung gerecht wurde. Facebook löschte demnach nur 39 Prozent der gemeldeten und rechtswidrigen Inhalte, Twitter sogar nur 1 Prozent. Rechtliche Regelungen scheinen also angebracht, um alle sozialen Netzwerke zur Einhaltung des deutschen Rechts zu bewegen.
Doch der Entwurf wurde überwiegend stark kritisiert. Zum Teil zu Unrecht, wie ich finde. Der Gesetzesentwurf macht sicher nicht alles richtig, ist aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Daher habe ich die drei größten Kritikpunkte am Entwurf ausgemacht und einmal näher angeschaut.
#1: Facebook als Richter?
Durch die vom Justizministerium geforderte Löschfrist von 24 Stunden kritisieren Einige, dass damit die Plattformbetreiber selbst entscheiden müssen, wann ein Inhalt „offensichtlich rechtswidrig“ ist und sofort gelöscht werden muss. Ein Gericht wird in der kurzen Zeit nicht herangezogen.
Das gleicht nach Ansicht vieler einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Privaten Unternehmen wie Facebook oder Twitter soll keine Rechtssprechung zuteil werden. Nur Gerichte sollen entscheiden dürfen, wann ein Inhalt strafrechtlich relevant ist.
Das ist doch gar nicht neu
Den Plattformbetreibern ein Gesetz vorzulegen, das ihnen erstens darlegt, wann etwas gelöscht werden soll und zweitens klar macht, was passiert, wenn sie es nicht tun, macht sie noch lange nicht zu einem Richter über gut und böse. Das Löschen von rechtswidrigen Inhalten auf der eigenen Plattform hat mit Rechtssprechung generell eher wenig zu tun.
Immerhin geht es hierbei nicht um die Verfolgung eines Straftäters, sondern lediglich um das Löschen von Inhalten, die in vielen Fällen andere Menschen verletzen oder diffamieren sollen. Unter Zuhilfenahme von Grundsätzen, die die privaten Plattformbetreiber nicht selbst formuliert haben. Das ist im übrigen gar nicht neu. Lediglich die Löschfristen und Strafen konkretisieren die Tatsache, dass Facebook, Twitter und Co. Hass im Internet effektiver entfernen sollen.
Außerdem sollen alle gelöschten Inhalte auf den Servern der Betreiber abgespeichert bleiben. So können die Urheber gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt werden oder sie selbst können Beschwerde über die unter Umständen ungerechtfertigte Löschung vorgehen. Die Plattformbetreiber sollen laut Gesetzesentwurf der echten Rechtssprechung also eher unterstützend zur Seite stehen. Die wirkliche Entscheidung über strafrechtlich relevante Fragen liegt daher noch immer bei Gerichten.
#2: Einschränkung der Meinungsfreiheit
Es besteht außerdem die Sorge, dass vor allem wegen der viel zu kurzen Löschfrist von 24 Stunden und der unverhältnismäßig hohen Strafen die Plattformbetreiber gemeldete Inhalte aus Angst eher von Vorhinein löschen als stehen lassen. Das befördere eine wahllose Löschkultur und schränkt konsequenterweise enorm die Presse- und Meinungsfreiheit ein und ist undemokratisch.
Hier treffen ganz klar zwei Welten aufeinander. Die schnellen Dynamiken des Internets kollidieren mit der langsamen, sorgfältigen und zum Teil überlasteten Rechtsprechung. In 24 Stunden kann kein Gericht beurteilen, ob ein Kommentar auf Facebook rechtswidrig ist und gelöscht werden soll. Doch die Löschung solcher Inhalte ist in vielen Fällen notwendig.
Und zwar so schnell wie möglich. Schon in 24 Stunden können hetzerische, diffamierende oder einfach beleidigende Inhalte in den ewigen Weiten des Internets geteilt und verbreitet worden sein. Es ist also schnelles Handeln geboten, das, wenn überhaupt, nur die Plattformen selbst bewältigen können. Undemokratisch hingegen wäre es, beispielsweise menschenverachtende oder volksverhetzende Inhalte stehen zu lassen.
Internet vs. Justiz
Und wer befürchtet, die Plattformanbieter würden aus Angst vor hohen Strafen vorsorglich alles Gemeldete löschen, kennt das Geschäftsmodell hinter Facebook, Twitter und Co. schlecht. Diese Plattformen leben von der Interaktion ihrer Nutzer, die davon ausgehen, dass das, was sie veröffentlichen, auch dort stehen bleibt.
Eine wahllose Löschkultur würde den wirtschaftlichen Selbstmord dieser Netzwerke bedeuten. Sie sind also dazu angehalten, genau zu prüfen, was unbedingt gelöscht werden muss und was nicht. Die Kapazitäten dazu haben sie. Grenzwertige Inhalte befördern in einem gewissen Rahmen die Interaktion der Nutzer mit den Plattformen.
#3: Hass eher an seinen Wurzeln bekämpfen?
Einigen geht der Entwurf außerdem nicht weit und tief genug. Hass im Internet müsse, neben der Löschung rechtswidriger Inhalte, an seinen Wurzeln bekämpft werden. Durch zum Beispiel demokratiefördernde Maßnahmen solle von vorhinein Hass in sozialen Netzwerken ausgeschlossen werden.
Den Entwurf als ersten Schritt verstehen
Dabei sollte man jedoch verstehen, dass der Umgang der Bundesregierung mit rechtswidrigen Inhalten in sozialen Netzwerken noch am Anfang ist. Der Gesetzesentwurf sollte außerdem als einer der ersten Schritte gegen Hass im Internet betrachtet werden.
Es ist nicht Aufgabe eines einzigen Ministeriums – vor allem nicht des Justizministeriums – ein riesiges, gesellschaftliches Problem allein anzugehen. Andere Ministerien arbeiten ebenfalls an Lösungen. Übrigens auch in Kooperation mit dem Justizministerium (zum Beispiel „Demokratie leben!“ des BmfFSFJ).
Plattformen mit in die Verantwortung ziehen
Der Gesetzesentwurf konkretisiert eigentlich nur bereits bestehende Regelungen und Vorgaben. Hass im Internet ist teilweise mit alten Maßnahmen nur schwer zu bekämpfen. Online gelten nun mal andere Verhältnisse. Hasskommentare verbreiten sich hier viel schneller, die Auswirkungen für Opfer können erheblich größer sein. Da ist es richtig, die Plattformen mit in die Verantwortung zu ziehen und nur Inhalte zuzulassen, die im Rahmen des Erlaubten stattfinden.
Den Entwurf als Ausgangspunkt von Zensur, einer Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit oder einer Privatisierung der Rechtssprechung zu bezeichnen, halte ich für falsch. Einer konkreten Alternativlösung gegen Hass im Netz mangelt es in den meisten Kritiken ohnehin. Und in einem sind sich schließlich fast alle einig. Irgendwas muss getan werden!
Auch interessant: Imagefilm zeigt, wie Facebooks Anti-Hass-Abteilung arbeitet