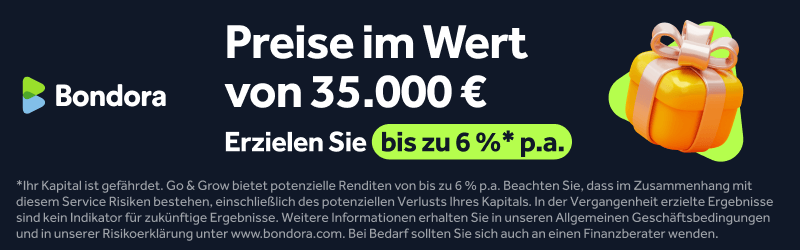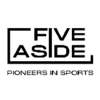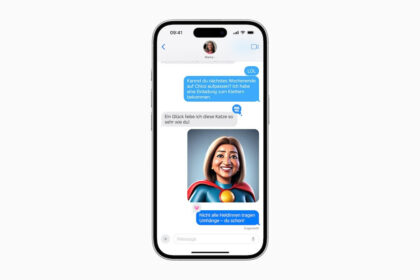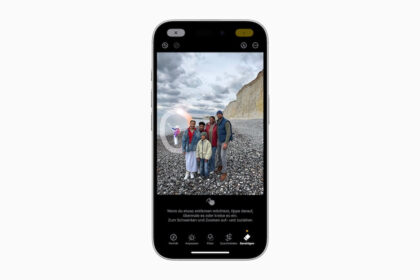Wenn ein Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung und das Marketing eines Produkts investiert, das sich bereits kurze Zeit nach seiner Markteinführung als Rohrkrepierer erweist oder gar wieder von der Bildfläche verschwindet, dann ist das in aller Regel nicht nur schlecht für die Bilanz, sondern auch fürs Image. Dass ein Unternehmen in einem solchen Fall dann dem oder den Verantwortlichen, wenn sie auffindbar sind, den Stuhl vor die Tür setzt, ist nachvollziehbar und in der freien Wirtschaft keine Seltenheit. Und doch ist das, was da am vergangenen Wochenende bei Apple passiert ist, in vielerlei Hinsicht „bemerkenswert“.
Wenn ein Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung und das Marketing eines Produkts investiert, das sich bereits kurze Zeit nach seiner Markteinführung als Rohrkrepierer erweist oder gar wieder von der Bildfläche verschwindet, dann ist das in aller Regel nicht nur schlecht für die Bilanz, sondern auch fürs Image. Dass ein Unternehmen in einem solchen Fall dann dem oder den Verantwortlichen, wenn sie auffindbar sind, den Stuhl vor die Tür setzt, ist nachvollziehbar und in der freien Wirtschaft keine Seltenheit. Und doch ist das, was da am vergangenen Wochenende bei Apple passiert ist, in vielerlei Hinsicht „bemerkenswert“.
Was war passiert? – Wie der Online-Ableger der „New York Times“ und zahlreiche andere Medien übereinstimmend berichteten, hat Mark Papermaster das Unternehmen mit dem Apfel-Logo verlassen. Er wurde vermutlich gefeuert, was von beiden Seiten aber nicht kommentiert wird. Im Zweifelsfall wird man sich aber wohl darauf verständigt haben, es offiziell wie einen persönlichen Abgang aussehen zu lassen (wofür gute Gründe sprechen würden, aber dazu gleich mehr). Warum erregt eine solche Banalität ein derartiges Medieninteresse? Weil es sich bei Papermaster um den Chef derjenigen Abteilung handelt, die bei Apple für die Entwicklung mobiler Geräte zuständig ist – und damit auch des iPhone 4. Direkt oder indirekt ist er somit für das Antennenproblem bei der neusten Generation der Cupertino-Smartphones verantwortlich. Apple hat also den Sündenbock gefunden und sich seiner entledigt – Ende der Meldung. Einzig: Ganz so einfach ist es nicht.
Da wäre nämlich zum einen der Umstand, dass es laut Apple doch eigentlich gar kein Antennenproblem gibt. Die aktuellen Quartalszahlen, die das Unternehmen erst kürzlich veröffentlicht hat, scheint die Behauptung zu unterstreichen, wenngleich in anderer Form. Die Abverkäufe wurden nämlich durch die Berichte über den „Todesgriff“ und dessen Folgen nicht negativ beeinflusst, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass sie als direkte Wirkung ausgemacht werden könnten. Die Kunden scheinen sie also entweder nicht zu stören oder sie nehmen sie billigend in Kauf.
Warum sich also von Papermaster trennen? Es ist doch alles noch mal gut gegangen. Immerhin dürften Microsoft mit dem KIN-Desaster oder Google mit dem Wave-Flop schlimmer gebeutelt gewesen sein. Von Schuldzuweisungen, rollenden Köpfen konnte man da aber nichts lesen. Vielmehr wurden (längst überfällige) Umstrukturierungen angekündigt und die Implementierung der gewonnen Erkenntnisse in künftige Projekte versprochen (im Falle des Software-Giganten könnte das möglicherweise auf den neuen Smartphone-Prototypen „Menlo“ zutreffen).
Ein möglicher Erklärungsansatz könnte in dem von Kritikern festgestellten Image-Schaden liegen, den Apple erlitten hat und der eine weitere Zusammenarbeit mit dem vermeintlichen „Sündenbock“ Papermaster unmöglich macht. Es dürfte wohl unstrittig sein, dass das Unternehmen sich zu einem sehr großen Teil über sein Image definiert und seit der Rückkehr von Steve Jobs zu einer Art Stil-Ikonen und Trendsetter im IT-Bereich avancierte. MacBooks, iPods, iPhones – sicherlich keine technischen Überflieger, aber design- und lifestyle-mäßig konkurrenzlos. Dass Steve Jobs jemanden, der diesem makellosen Ruf einen Kratzer zufügt, nicht länger in seinem Unternehmen haben will, wäre keine Überraschung.
Hinzu kommt: Anders als andere Smartphone-Hersteller bietet Apple nur ein Modell an, das in regelmäßigen Abständen vom Nachfolger abgelöst wird. Eine Mischkalkulationen wie sie etwa bei Nokia denkbar ist, wonach schlechte Verkaufszahlen bei dem einen Modell durch bessere bei einem anderem Modell ausgeglichen werden, greift bei Apple in der Form nicht. Winkt der Leiter einer Abteilung, die ein fehlerhaftes Antennen-Design entwickelt, dieses durch und gefährdet damit den Erfolg eines Flaggschiff-Produkts und in Folge dessen den des gesamten Unternehmens – der ist für Letzteres nicht mehr tragbar. Dabei immer vorausgesetzt, dass Papermaster tatsächlich verantwortlich für das Antennen-Problem ist.
Wäre dann aber sein Rausschmiss nicht eigentlich ein Schuldeingeständnis Apples, dass es tatsächlich ein Antennenproblem gibt? Es wäre zumindest schwierig, diesen Eindruck wegzudiskutieren. Also behilft man sich eines Kunstgriffes und trennt sich ohne offizielle Angabe von Gründen. Papermaster willigt in den Deal ein, weil er dadurch von Apple nicht als „Sündenbock“ stigmatisiert wird und damit bei seinem nächsten Arbeitgeber sicherlich bessere Karten auf eine Einstellung hat. Und Apple wahrt das Gesicht oder noch besser: lässt die Presse das Naheliegendste denken – Papermaster ist schuld.
Vielleicht liegen die Dinge aber auch ganz anders. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Mark Papermaster schon viel früher das Vertrauen von Steve Jobs verloren, mit der Entwicklung des iPhone 4 kaum noch was zu tun hatte, deswegen auch nicht in dem Promotion-Video für das Gerät auftaucht und jetzt seinen Hut nehmen musste. Ein offizielles Statement wie im Fall von HP-Chef Mark Hurd wäre da doch um so viel einfacher. Vermutlich würde solche Transparenz aber zu viel Licht auf die internen Abläufe bei Apple scheinen lassen, auf deren Geheimhaltung ja so viel wert gelegt wird. Und möglicherweise würde sie ein unbequeme Wahrheit zutage fördern: Dass Apple nämlich etwas verlangte, für das weder Papermaster noch jemand anders eine Lösung liefern konnte, nämlich die neue designte Antenne ohne die „Todesgriff“-Anfälligkeit. Dann würde aber auch klar, dass Jobs doch schon frühzeitig über dieses Problem informiert worden war…
(Marek Hoffmann / Foto: Edibleapple)